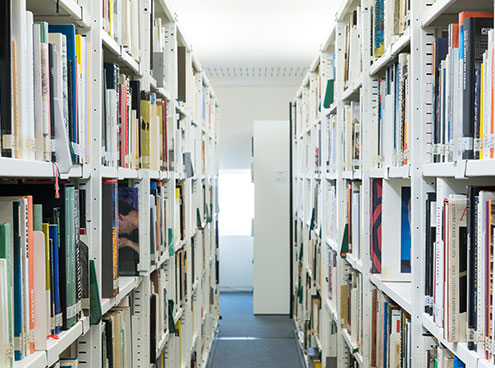Provenienzforschung

Die Erforschung der Herkunft der Kunstwerke, der Werdegang eines Gemäldes, einer Zeichnung, einer Skulptur und so weiter, gehört zu den zentralen Aufgaben jedes Museum und aller öffentlichen Sammlungen. Das Schicksal eines Werkes seit seinem Entstehen kann Aufschluss über seine Bedeutung geben.
Ausgangslage
Die als Provenienzforschung bezeichnete Wissenschaft erhielt – bezogen auf die Bestände der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen – besondere Bedeutung mit der Washingtoner Erklärung der „Jewish Claims Conference“ vom Dezember 1998. Es folgte eine „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“. Die Museen und öffentlichen Sammlungen haben sich damit verpflichtet, die Provenienzforschung besonders auf die Werke in ihrem Bestand zu richten, die die Besitzer*innen in den Jahren zwischen 1933 bis 1945 gewechselt haben.
Auch in der Kunstsammlung war und ist die Recherche zur Provenienz ihrer Bestände ein zentrales Aufgabengebiet. Bereits Gründungsdirektor Werner Schmalenbach bemühte sich, die Herkunft der ihm anvertrauten und von ihm erworbenen Werke zu klären. Seine Arbeit setzten die ihm nachfolgenden Leitungen fort. Auch heute wird Provenienzforschung in der Kunstsammlung betrieben.
Vorgehen
Für die Recherchen standen seit Herbst 2009 mit finanzieller Unterstützung der Berliner Arbeitsstelle für Provenienzforschung zwei Kunsthistorikerinnen zur Verfügung. Sie haben die Bestände systematisch überprüft: So wurden die mit dem Erwerb angelegten Bildakten der Kunstwerke gesichtet, in denen unter anderem Briefwechsel und Fotografien aufbewahrt werden. Bildrückseiten wurden untersucht, um Etiketten und andere Aufschriften auszuwerten. Schließlich führten umfassende und gezielte Literatur- und Archivstudien im In- und Ausland zu vielfachen Provenienz-Hinweisen. Alle Ergebnisse wurden und werden in einer eigens konzipierten Datenbank zusammengeführt.
Weitere Angebote